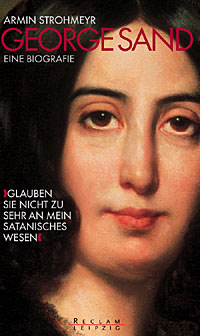 George Sand – Schriftstellerin,
Bürgerrechtlerin, Frau mit Esprit George Sand – Schriftstellerin,
Bürgerrechtlerin, Frau mit Esprit
Von Armin Strohmeyr
Der Philosoph Proudhon beschimpfte sie als "Symbol der Unmoral
und des Niedergangs", die Brüder de Goncourt nannten ihre
Autorenkollegin eine "Fratze aus einem etruskischen Grab". Kaum
eine Gestalt der französischen Geistesgeschichte wurde ähnlich von
Klischees und Vorurteilen umstellt wie George Sand. Neid auf ihre
Erfolge und Verstörung durch ihre Übernahme traditionell männlicher
Accessoires und Verhaltensmuster mögen dazu beigetragen haben.
Am 1. Juli 1804 wurde die französische Schriftstellerin George Sand
geboren. Aurore Dupin, wie sie eigentlich hieß, war Tochter eines
Offiziers (der Ururgroßvater war kein Geringerer als August der
Starke von Sachsen) und einer einfachen Frau aus dem Volke. Die
Abstammung aus unterschiedlichen Klassen wurde prägend für das
gesellschaftliche Selbstverständnis der Schriftstellerin.
Romantikerin und Radikale
George Sand wurde mit Liebesromanen bekannt. Doch zunehmend
wandelte sich die Autorin zu einer der schärfsten Anklägerinnen der
sozialen und politischen Verhältnisse im Frankreich der Restauration.
In den Jahren vor der Revolution von 1848 radikalisierte sich ihr
Denken. Entscheidend hierzu trug die Bekanntschaft mit
Sozialreformern, Philosophen und Revolutionären jeglicher Couleur
bei. Sie kannte den in Paris im Exil lebenden Jungdeutschen Heinrich
Heine und stand im Briefwechsel mit dem russischen Anarchisten Michail
Bakunin. Karl Marx glaubte, sie auf seine Seite ziehen zu können –
doch George Sand zeigte sich eher von den französischen
Sozialutopisten beeinflusst. Die Herrin des Guts Nohant bewegte sich
eine Zeitlang im Kielwasser von Pierre-Joseph Proudhon, der
behauptete, Eigentum sei Diebstahl – für George Sand kein
Widerspruch. So bemühte sie sich auf ihrem eigenen Gut und in ihrem
Heimatdorf um verbesserte Lebensbedingungen der Bauern und
Tagelöhner, half oftmals aus eigener Tasche unschuldig in Not
geratenen Menschen und organisierte bei einer Typhusepidemie
ärztliche und sanitäre Hilfe. Als "gute Dame von Nohant"
wurde sie von manchen bespöttelt, von den meisten jedoch mit
Hochachtung genannt.
Enttäuschung, Exkommunikation ...
Doch die Hoffnungen auf eine gerechtere Gesellschaft wurden in der
Zweiten Republik von 1848 schnell enttäuscht. Die bürgerliche Klasse
unterdrückte die sozialistischen Bewegungen mit Waffengewalt.
Schließlich riss Louis-Napoléon Bonaparte in einem Staatsstreich die
Macht an sich und ließ sich zunächst zum "Fürst-Präsidenten",
später zum Kaiser ausrufen. Etliche sozialistische Freunde George
Sands wurden verhaftet und in die Verbannung geschickt. George Sand
zog sich enttäuscht nach Nohant zurück. Dort schrieb sie Romane und
Theaterstücke, worin sie in verschlüsselter Form den operettenhaften
Talmiglanz des Empire bespöttelte. Wegen ihrer zunehmend feindlichen
Gesinnung gegen die päpstliche Kirche wurde sie 1863 exkommuniziert,
ihr Werk auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt. Beides nahm sie
mit Gleichgültigkeit hin. Ihr Ruf war inzwischen zur Legende
geworden, und selbst Kaiser Napoleon III. konnte nicht umhin, ihren
vielfältigen Bitten um Amnestie und Rehabilitation befreundeter
Sozialisten, die im Gefängnis schmachteten oder sich im Exil
befanden, stattzugeben.
Manche ihrer gesellschaftspolitischen Ideen mögen heute
uneinlösbar, maßlos oder von der Geschichte überholt scheinen. Was,
außer ihrem riesigen schriftstellerischen Werk, jedoch bleibt, ist
das Lebensbild einer unbeugsamen Frau, die für ihre Überzeugungen
viel gewagt und sich und der Umwelt viel abgefordert hat.
Zum Weiterlesen:
Armin Strohmeyr: George Sand. Eine Biografie
"Glauben Sie nicht zu sehr an mein satanisches Wesen"
Reclam Verlag Leipzig 2004 Verlagsinfo
240 S. 20 Abb. Geb., ISBN 3-379-00808-7
EUR (D) 19,90 / EUR (A) 20,50 / sFr 34,90
Über den Autor
Armin Strohmeyr, geboren 1966, lebt als Autor und
Publizist in Berlin. Er veröffentlichte Biografien zu Klaus und Erika
Mann und zu Annette Kolb.
(Wiedergabe in den Quickshots mit freundlicher Genehmigung von
Armin Strohmeyr und Reclam Verlag. Copyright © Armin Strohmeyr 2004.)
|